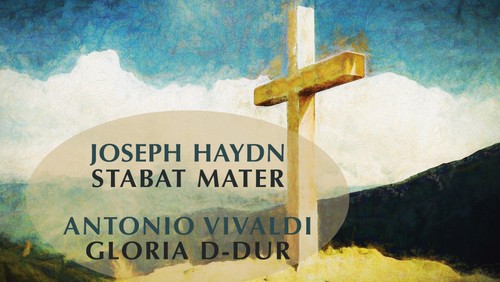
16/10/2025 0 Kommentare
15.11.25 um 18 Uhr ∙ Konzert zum Kirchenjahresende ∙ Einführung
15.11.25 um 18 Uhr ∙ Konzert zum Kirchenjahresende ∙ Einführung
# Nachrichten
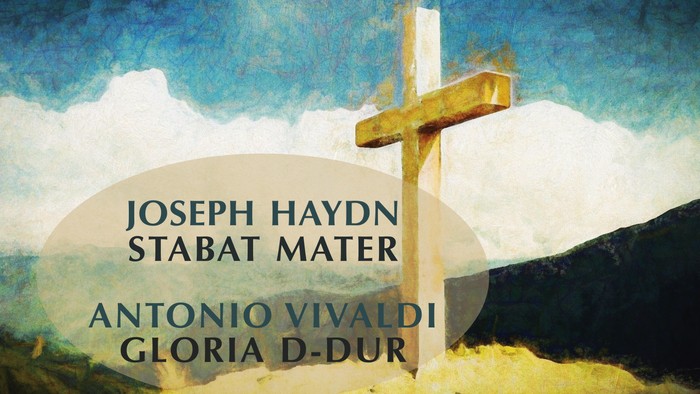
15.11.25 um 18 Uhr ∙ Konzert zum Kirchenjahresende ∙ Einführung
ZUM KIRCHENJAHRESENDE LADEN WIR SIE HERZLICH ZU EINEM BESONDEREN KONZERT IN UNSERE NIENSTEDTENER KIRCHE EIN!
Zwei wunderbare Werke für Soli, Chor und Orchester gehen in diesem Konzert eine tröstliche Verbindung ein:
Das Stabat Mater von Joseph Haydn und Gloria D-Dur von Antonio Vivaldi
führen uns auf ergreifende musikalische Weise durch den Schmerz und die Trauer hin zum ewigen Licht und schenken uns eine tiefe Hoffnung und Zuversicht.
Ausführende: Kantorei Nienstedten & Gäste, Sopran: Caroline Bruker, Alt: Sonja Boskou, Tenor: Timo Rössner, Bass: Leon Teichert, Orchester, Leitung: Frauke Grübner
Karten sind im Kirchenbüro und in der Nienstedtener Buchhandlung sowie unter diesem Link erhältlich: Konzertkarten Online
Das Stabat Mater wird erstmals in unserer Nienstedtener Kirche erklingen. Lesen Sie hier die Einführungen zu beiden Werken:
STABAT MATER · JOSEPH HAYDN
Die Bedeutung Joseph Haydns als Komponist geistlicher Vokalmusik wird im heutigen Bewusstsein vor allem bestimmt durch die Oratorien seines Spätwerks, Die Schöpfung und Die Jahreszeiten, sowie die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze. Im Bereich der liturgischen Kirchenmusik gelten vornehmlich seine großbesetzten Messen – ebenfalls der späteren Jahre – als Gipfelpunkt der Epoche und darüber hinaus. Angesichts dessen rückte Haydns erstes größeres Kirchenwerk, das bereits 1767 entstandene Stabat Mater, zu Unrecht in die „zweite Reihe“ seines Schaffens. Denn es war gerade dieses Werk, das Joseph Haydn nicht nur als „Kirchenkomponist“ bekannt machte, sondern das die wohl größte Verbreitung und die meisten Aufführungen im Bereich seines Vokalschaffens zu seinen Lebzeiten erfuhr. Noch bis weit in das 19. Jahrhundert hinein galt das Werk als Inbegriff der Passionsmusik, und das sowohl in katholischen als auch in protestantischen Gegenden Mitteleuropas. Diese Diskrepanz in der Wertschätzung der Komposition mag einerseits in den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufscheinenden und vor allem ästhetisch konnotierten begrifflichen Antipoden eines „Frühwerks“ und eines „Spätwerks“ eines Komponisten begründet sein. Auch das damit zusammenhängende evolutionistisch geprägte Musikgeschichtsbild dürfte eine Rolle spielen, in dem die „musikalische Klassik“ als Gipfel- und Zielpunkt einer Entwicklung begriffen wird, die Kompositionen der 1760er- und 1770er-Jahre dagegen nur als Vorläufer verstanden und als „Vorklassik“ diskreditiert wurden. Inzwischen jedoch rückt der besondere Reiz der Tonsprache dieser Epoche zwischen Barock und Klassik wieder ins Bewusstsein, sodass die entsprechenden Kompositionen mehr und mehr Wertschätzung erfahren. In seinen frühen Jahren und selbst nach den ersten Jahren seiner Anstellung als Kapellmeister am Esterházyschen Hof ab 1761 hatte Joseph Haydn, der zu dieser Zeit bereits über 40 Sinfonien und zahlreiche weitere Instrumentalwerke aus seiner Feder vorweisen konnte, außer etwa einer Hand voll kleinerer Stücke keine Kirchenmusik komponiert. Dies änderte sich, nachdem er neben der Kammer- und Theatermusik im Jahr 1766 auch die Leitung der Kirchenmusik von seinem verstorbenen Vorgänger Gregor Joseph Werner übernahm. Bereits am 17. April 1767 dürfte Haydns erstes größeres geistliches Vokalwerk, sein Stabat Mater, im Rahmen der traditionellen oratorischen Karfreitagsaufführungen in der Eisenstädter Schlosskapelle erstmals erklungen sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Stück erneut bereits am Karfreitag des Folgejahres in Wien, in der Kirche der Barmherzigen Brüder, unter Haydns Leitung zur Aufführung gekommen. Kein geringerer als Johann Adolph Hasse, der seit 1764 in Kaiserlichen Diensten stand und der nach dem Studium der Partitur des Stabat Mater „unaussprechliches Lob über dieses Werk“ äußerte, hatte die Einladung für Haydn vermittelt. Am 29. März 1771 führte Haydn das Werk abermals als Teil einer Karfreitagsvesper in Wien auf, diesmal in der Piaristen-Kirche Maria Treu in der Josephstadt; laut Kirchenchronik mit einer stattlichen Zahl von 60 Musikern. In der Folge kam es bis mindestens 1783 zu regelmäßigen Wiener Aufführungen, sodass von dort Haydns Stabat Mater sehr bald seinen Siegeszug durch zahlreiche Kirchen und Konzertsäle antreten konnte. So lässt sich aus Provenienzen früher Abschriften, die oft in Wiener Kopistenbüros entstanden, schließen, dass das Stück innerhalb der ersten 15 Jahre nach seinem Entstehen sowohl in Kirchen bedeutender Klöster und Schlösser als auch größerer Städte vor allem in österreichischen, süddeutschen, böhmischen und auch italienischen Gebieten musiziert wurde. Von der immensen Anzahl von ca. 180 erhaltenen Abschriften stammen allein über 40 aus den Jahren vor 1790. Nicht nur als Musik in Fasten- und Passionsandachten, sondern frühzeitig auch als Repertoire-stück in Concerts spirituels fand das Stabat Mater große Beliebtheit bei einem breiten Publikum. Erstmals in einem solchen Geistlichen Konzert erklang das Werk 1779 in der Leipziger Universitätskirche, geleitet und mit einem deutschen Parodietext versehen von Johann Adam Hiller. Kurz darauf und dann regelmäßig bis zur Französischen Revolution war es auch Teil der in Paris stattfindenden Concerts spirituels in der Fastenzeit. Die nächste Welle des Erfolgs erfasste dann auch die protestantischen Gebiete Nord- und Mitteldeutschlands, ausgelöst durch den 1782 erschienenen Klavierauszug, den der Herausgeber J. A. Hiller mit dem deutschen Text seiner Leipziger Aufführung 1779 unterlegt hatte, der, wie es im entsprechenden Vorwort dazu heißt: „in Kirchen und Versammlungen gebraucht werden kann, wo der lateinische Text nicht schicklich ist“. Zum Teil dadurch beeinflusst, oft aber unabhängig voneinander, entstanden nun zahlreiche deutsche Neutextierungen zu Haydns Stabat Mater, die starke Verbreitung fanden.
Die lateinische Dichtung der Stabat-Mater-Sequenz stammt ursprünglich aus dem späten 13. Jahrhundert. Sie ist wohl im Umkreis des Franziskanerordens entstanden und umfasst 10 sechszeilige Strophen. Seit dem Tridentinum jedoch durfte sie nur noch außerhalb der Messe gesungen werden, bis sie 1727 einen neuen liturgischen Ort fand – das Fest der Sieben Schmerzen Mariens, das in diesem Jahr als für die ganze Kirche verbindlich eingeführt und auf den Freitag vor dem Palmsonntag festgelegt wurde.
Haydn besetzte sein Stabat Mater mit vierstimmigem Chor und Solisten, zwei Oboen bzw. Englischhörnern, Streichern und Basso continuo durchaus üppig. Zwar gibt es im 18. Jahrhundert auch doppelchörige oder mit zusätzlichen Blasinstrumenten besetzte Vertonungen, oft jedoch beschränkten sie sich auf eine Begleitung mit „Kirchentrio“ oder, wie im Fall des berühmten Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesis, auf nur zwei Vokalstimmen. Mit letztgenanntem hat Haydns Stabat Mater zwar nicht die Besetzung, jedoch auffallende musikalische Formen und Charakteristiken gemeinsam. Bereits die Zeitgenossen erkannten in anklingenden neapolitanischen Elementen ebenso wie in der außerordentlichen Kantabilität mancher Sätze eine Reminiszenz an die stilbildende und damals noch allenthalben präsente Vertonung Pergolesis. Und noch eine Gemeinsamkeit – und zwar hinsichtlich der Rezeption – ist zu konstatieren: Auch das Pergolesi-Stück hatte Hiller als Klavierauszug gedruckt und mit deutschem Text, in dem Fall der Nachdichtung Friedrich Gottlieb Klopstocks, unterlegt. Und so verwundert es nicht, dass dem Haydn’schen Werk ein ähnlicher Erfolg beschieden war wie dem Pergolesis, deren Platz als vorbildhafte Stabat-Mater-Vertonung es nun nach und nach einnahm.
Für eine geplante Wiederaufführung seines Stabat Mater im Jahr 1803 beauftragte Haydn seinen Schüler Sigismund Neukomm, zusätzliche Bläser- und Paukenstimmen dazu zu komponieren. Haydn ließ das Stück daraufhin in dieser „vermehrten Instrumentierung“ dem Verleger G. C. Härtel anbieten, der es schließlich in dieser Form und erneut mit zweisprachiger Textunterlegung kurz darauf druckte. Diese nur bedingt vom Komponisten autorisierte Bearbeitung des Stückes muss zweifellos vornehmlich als Zugeständnis an den sich geänderten Zeitgeschmack verstanden werden; der intime Charakter weicht zugunsten des durch den Zusatz der Harmonieinstrumente nun vollen Orchesterklanges. Das sich in 14 Nummern gliedernde hochgradig abwechslungsreiche Stück, das Haydn selbst übrigens in seinem Verzeichnis 1805 den „Oratorien“ zuordnete, weist einen beachtlichen zeitlichen Umfang von ca. 60 Minuten auf. Ist es zum einen ein musterhaftes Beispiel des empfindsamen Stils, so zeigt sich zugleich aber bereits das klassische Ideal der Einheit in Vielfalt. Verschiedene musikalische Formen, Gesten und Besetzungen wechseln sich in ausdrucksvollen Arien, Duetten und Ensemblesätzen ab. Die einzelnen, durchgängig noch mit beziffertem Bass bezeichneten Sätze sind dabei musikalisch aufeinander bezogen und lassen eine kluge Dramaturgie erkennen. Der Gestus des Klagegesangs wird bereits im solistischen Beginn durch sinnfällige musikalische Figuren, wie dem passus-duriusculus-ähnlichen chromatischen Abstieg bei der Wiederholung des Textwortes „dolorosa“ oder die mit Pausen durchsetzten Seufzer im Melisma zu „lacrimosa“ verdeutlicht. Im folgenden Alt-Solo „O quam tristis et afflicta“ kommen erstmals die tiefen Corni inglese statt der Oboen zum Einsatz; einem zunächst homophonen, dann fugischen Chor folgt eine klanglich etwas aufgehellte Sopranarie, die wiederum von einem schnellen, unisono beginnenden Bass-Solo kontrastiert wird. Einer harmonisch gewagten Tenorarie folgt als Mittelpunkt der Komposition der Chor Nr. 7 „Eja Mater“. Das ausladende Duett „Sancta Mater, istud agas“ und das Alt-Solo „Fac me vere tecum flere“ bereiten den durch dichte thematische Arbeit gekennzeichneten Chor „Virgo virginum praeclara“ vor. In der Bass-Arie Nr. 11 werden die „Flammen“ durch die weiten Tonsprünge in Verbindung mit den repetierenden Doppelgriffen der zweiten Violinen sinnfällig und in dramatischer Weise dargestellt. Das folgende Tenor-Solo beruhigt ein wenig die Szenerie vor dem Höhe- und Schlusspunkt der beiden Chöre Nr. 13 und 14. Hervorzuheben ist insgesamt die erstaunliche Fülle an verschiedenen Klangwirkungen, die selbst an dramatischen Stellen keine düstere, sondern nahezu immer eine angesichts der Gewissheit des Versöhnungstodes Jesu zuversichtliche und helle Grundstimmung erzeugen, die von der strahlenden, fast schon majestätisch-jubelnden Schlussfuge „Paradisi gloria“ gekrönt wird. Dem damaligen Hörer galt „Haydns Meisterstück“ dennoch nicht nur als würdig, sondern als Inbegriff der ernsthaften, reflektierend anbetenden Passionsmusik, als ein „vortreffliches Stück, dessen Schönheit sehr rührend, dessen Ausdruck sehr richtig, und das einzige ist, so sich an der Seite des Pergolesischen hat erhalten können“ (C. F. Cramers Magazin der Musik, 1783).
Clemens Harasim (Carus Verlag)
GLORIA D-DUR · ANTONIO VIVALD
Die Wiederbelebung der Musik Antonio Vivaldis im 20. Jahrhundert ging einher mit der Neuentdeckung bisher völlig unbekannter Schaffensbereiche des Komponisten. Für die stärksten Überraschungen sorgte dabei ein großer Bestand an geistlicher Vokalmusik, dessen Repertoire von der groß angelegten Mess- und Vesperkomposition bis zum biblischen Oratorium und zur Solomotette reicht. Die ersten Wiederaufführungen solcher Werke, darunter das Gloria RV 589 und das Credo RV 591, während einer Vivaldi-Woche in Siena 1939 wurden geradezu als Sensation empfunden. Sie ließen deutlich werden, dass der Komponist gerade auf diesem Sektor Werke höchsten künstlerischen Ranges geschaffen hat. Wie kaum ein zweites Werk hat das Gloria D-Dur RV 589 dazu beigetragen, den Ruf Vivaldis als Kirchenkomponist zu begründen. Seit es 1941 als erstes der kirchen-musikalischen Werke des Komponisten durch Druck veröffentlicht wurde, erfreut es sich der besonderen Gunst der Musizierenden und der Hörer. Die Gründe dafür mögen vielfältiger Natur sein, liegen aber gewiss primär bei der Kraft und dem Reichtum der musikalischen Erfindung und Ausdrucksgebung. Vivaldi folgt in der kompositorischen Anlage des Werkes der gleichen Grund-konzeption, wie man sie aus Bachs h-Moll-Messe kennt: Gliederung der Komposition in eine größere Zahl in sich abgeschlossener Einzelsätze, die teils als Chorsätze, teils als Soloarien oder Duette vertont werden. Es ist dies das Prinzip der sogenannten »Kantaten«- oder »Nummernmesse«, das dem Komponisten eine breite musikalische Entfaltung einräumt und in besonderer Weise das »verweilende« Ausloten zentraler Textgedanken in charakteristisch unterschiedenen kompositorischen Formen ermöglicht. So leben die zwölf Sätze von einer großen Vielfalt unterschiedlicher musikalischer Charaktere von zugleich beträchtlicher stilistischer Spannweite: Streng geformte Chorsätze haben ihren Gegenpol in leichten, ganz in Concerto-Art gehaltenen Arien oder Duetten (»Laudamus te«). Welch ein weites Empfindungsspektrum eröffnet sich allein in den drei »Domine«-Sätzen! Der bei weitem ausgedehnteste Satz und zugleich das Herzstück der Komposition ist der Chorsatz »Et in terra pax«. Ein ruhig fließendes Andante in h-Moll, im Instrumentalen allein auf die Streicher gestellt, betont – in denkbar starkem Kontrast zum »Gloria«-Jubel des Beginns – ganz das nach innen Gerichtete des Friedens-gedankens. Zu den Besonderheiten der meisterhaft gestalteten Komposition gehört es, dass das musikalische Geschehen in zwei motivisch strikt voneinander abgehobenen Schichten abläuft: einem von weiträumiger Intervallik, gleichmäßig pulsierenden Achtelfolgen und dichten Tonrepetitionen geprägten Instrumentalpart und einem von expressiver Chromatik beherrschten motettischen Chorsatz. Erwächst hieraus eine den Satz von Beginn an kennzeichnende besondere Dichte und Intensität, so bringt der Komponist in der zweiten Satzhälfte noch ein Moment nachdrücklicher Steigerung ein: Indem er die bis dahin kontrapunktisch-linear geführten Chorstimmen zu einem akkordischen Satz zusammenballt und – zugleich mit dem Übergang zu emphatisch strömender Melismatik – in kühnen, mitunter geradezu »romantisch« anmutenden Harmoniefolgen entlegenste Klangregionen durchmisst, erreicht er ein Ausdrucks-Crescendo von großer Eindringlichkeit. Die formale Rundung der vielteiligen Komposition schafft Vivaldi mit der devisen-artigen Wiederaufnahme der Anfangsthematik im »Quoniam«, in dem auch erstmals die Trompete wieder zum Einsatz kommt. Für den traditionell als Fuge gestalteten Schlussteil des Gloria, das »Cum sancto spiritu«, bedient der Komponist sich wiederum einer fremden Vorlage: Die im stile antico gestaltete Doppelfuge folgt der »Cum sancto spiritu«-Fuge seines wenig bekannten älteren Zeitgenossen Giovanni Maria Ruggieri.
Karl Heller (Carus Verlag)


Kommentare